ELITEN
Bundestag 1990 – 1992
Nach Herstellung der deutschen Einheit fanden im Bundestag mehrere Debatten statt, die um die Frage des Umgangs mit Eliten aus Staat, Justiz und Verwaltung der DDR gingen.
Kritik an den Regelungen des Einigungsvertrags
Im ersten gesamtdeutschen Parlament konnte man zunächst auf die im Einigungsvertrag festgelegten Regelungen hinsichtlich der Weiterbeschäftigung oder Entlassung von Personen im öffentlichen Dienst aufbauen. Kritik an diesen Richtlinien wurde vor allem seitens der PDS/Linken Liste laut. So sprach sich der Abgeordnete Uwe-Jens Heuer für einen Kündigungsschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes der ehemaligen DDR aus, deren Einrichtungen nicht durch die Bundesrepublik übernommen wurden. Diese Personen befanden sich in einer Art Warteschleife von sechs bzw. neun Monaten. Danach sollte entschieden werden, ob sie weiter beschäftigt werden oder nicht. Seine Kritik untermalte Heuer mit einem Verweis auf die Regelungen nach dem Grundgesetz Artikel 132, die es erlaubten, Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes des nationalsozialistischen Deutschlands in den Ruhestand, den Wartestand oder in ein Amt mit niedrigerem Diensteinkommen zu versetzen, sollte ihnen die fachliche oder persönliche Eignung für ihr Amt gefehlt haben. Die betroffenen Personen hatten das Recht auf eine gerichtliche Überprüfung des sie betreffenden Verfahrens. Dieses Recht forderte Heuer auch für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes der DDR ein.
Diesem Thema widmete die Gruppe PDS/Linke Liste kurze Zeit später auch einen Entschließungsantrag unter dem Titel „Kündigungsschutz für bisherige Angehörige des öffentlichen Dienstes der ehemaligen DDR“ und die Einberufung einer aktuellen Stunde am 26. April 1991. Zu dieser Zeit hatte das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Warteschleifenlösung zwar bereits als verfassungskonform bezeichnet, jedoch eine Abmilderung von sozialen Härten für besonders betroffene Arbeitnehmer gefordert. Auch in dieser Debatte wurde vonseiten der PDS/Linken Liste und ihres Vorsitzenden Gregor Gysi auf den Artikel 132 des Grundgesetzes eingegangen und auch auf die daraus geschlossenen Regelungen in der westdeutschen Nachkriegszeit. Nur etwa tausend Personen seien in der Nachkriegszeit aufgrund des Gesetzes aus dem Dienst ausgeschieden, dies stehe – so Gysi – in keinem Verhältnis zur aktuellen Situation in den neuen Bundesländern. Gysi sprach sich gegen die „politische Ausgrenzung“ von „hunderttausenden“ Menschen aus, denen man auch eine Chance auf Integration in die Gesellschaft geben müsse. Weiter kritisierte Gysi die Praxis der Abwicklung von öffentlichen Einrichtungen. Abwicklungsverfahren konnten eingeleitet werden, wenn öffentliche Einrichtungen aufgelöst und nicht im vereinten Deutschland weitergeführt wurden. Laut Gysi gebe es aber Fälle (er nannte den Wissenschaftsbereich), bei denen der Begriff der Abwicklung genutzt werde, obwohl die Struktur erhalten bleibe. Das Verfahren der Abwicklung werde offenbar nur benutzt, um das Personal auszutauschen. Dieses Vorgehen sei nun durch das Bundesverfassungsgericht gekippt worden. Gysi forderte die Bundesregierung auf, die bereits erfolgten Maßnahmen hinsichtlich der Entlassung des Personals rückgängig zu machen.
Als Reaktion auf diesen Vorstoß der Gruppe PDS/Linke Liste entgegneten die Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP, dass die „aufgeblähte“ DDR-Verwaltung nicht ins vereinte Deutschland überführt werden könne. Mit dem Neuaufbau der Verwaltung in den neuen Bundesländern sei zwingend auch ein Personalabbau verbunden. Diese Ansicht wurde auch von der Bundesregierung vertreten: In einem freiheitlichen Staat sei vieles, was unter kommunistischen Verhältnissen Teil des öffentlichen Dienstes war, in freier Trägerschaft. Das von Gysi beschriebene Phänomen der „Scheinabwicklung“ wurde als nicht bekannt abgestritten. Die SPD-Fraktion erklärte, dass es in der Vergangenheit durchaus „Scheinabwicklungen“ gegeben habe, sie wies jedoch die Vergleiche mit der unmittelbaren Nachkriegszeit und dem Umgang mit ehemaligen Funktionsträgern des Nationalsozialismus zurück:
„Unter diesen Umständen kann ich es überhaupt nicht verstehen, wenn von der äußersten linken Seite dieses Hauses die Forderung erhoben wird, mit ähnlich unentschuldbarer Nachsicht, wie man zum Teil mit Nazi-Funktionären nach 1945 bei uns in der alten Bundesrepublik, aber auch in der DDR umgegangen ist, auch mit SED-Bonzen zu verfahren. Mir erscheint das als eine ganz merkwürdige Gleichsetzung von NSDAP und SED; die ausgerechnet aus Ihrem Munde hier, Herr Gysi, kommt.“ Johannes Singer (SPD), Deutscher Bundestag, 12/24, 26.4.1991, S. 1655.
Dokument
-

Antrag der PDS/Linken Liste: Kündigungsschutz für bisherige Angehörige des öffentlichen Dienstes der ehemaligen DDR, DS 12/392, 18.4.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
Die Überprüfungs-
möglichkeiten nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz
Auch die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kritisierte die bisherigen Regelungen im Einigungsvertrag, die ihrer Ansicht nach zu wenig differenziert und zu wenig ausformuliert seien. Anfang 1991 gab es weder ein einheitliches Verfahren der Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit noch einheitliche Überprüfungskriterien. Ein langfristiges Ziel solle jedoch ein „gesellschaftlicher Konsens“ sein, „wie man einerseits diesen Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie letztlich Resozialisierung gewähren kann und andererseits ihre erneute Besetzung von Macht- und Einflußpositionen […] verhindern kann“. Die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderte Ende März 1991 in einem Antrag die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die künftigen Einsatzmöglichkeiten von offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des MfS/AfNS sowie die Überprüfungen von Personen auf Stasi-Mitarbeit regeln sollte. Der Gesetzentwurf sollte festlegen, in welchen Bereichen und Berufszweigen Angehörige des MfS/AfNS künftig nicht arbeiten dürften. Die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderte dabei explizit, dass Leitungspositionen etwa in der Justiz, in der Politik, aber auch im Erziehungsbereich nicht von entsprechenden Personen wahrgenommen werden sollten. Die bisherige Methodik der Überprüfung müsse auf Effektivität, Verhältnismäßigkeit und künftige Notwendigkeit untersucht werden.
Dieser Antrag spricht sich eindeutig gegen Überprüfungsverfahren aus, wie sie im Westen Deutschlands eingesetzt worden waren. Hier ist vermutlich – ohne, dass dies explizit ausgedrückt wird – die Überprüfungspraxis im Zuge des sogenannten Radikalenerlasses aus den 1970er-Jahren gemeint, die durch Anfragen beim Bundesamt für Verfassungsschutz die Einstellung von Personen verhinderte, die in bestimmten legalen, aber als radikal eingestuften Organisationen tätig waren.
Der Antrag wurde gemeinsam mit den Entwürfen für das Stasi-Unterlagen-Gesetz in der Plenarsitzung am 18. April 1991 beraten. Das Stasi-Unterlagen-Gesetz, über das am 14. November 1991 abgestimmt wurde, beinhaltete schließlich auch Regelungen hinsichtlich der Überprüfung bestimmter Personengruppen auf Stasi-Mitarbeit. Im Gesetz wurde in Paragraf 20 und 21 genau festgelegt, welche Unterlagen von öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen herangezogen werden durften, um genau definierte Personengruppen überprüfen zu können. Nicht überprüft werden konnte jedoch, ob eine Person vor Vollendung des 18. Lebensjahres für die Stasi gearbeitet hat. Dies geschah laut des FDP-Abgeordneten Burkhard Hirsch, um „Jugendsünden“ auszuklammern. Kritisiert wurden die Regelungen von der Gruppe PDS/Linke Liste, die darin keine Aufarbeitung der Vergangenheit, sondern eine „Abrechnung“ sah.
Dokumente
-

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sicherheitsprüfung und künftiger beruflicher Einsatzmöglichkeiten von ehemaligen Mitarbeitern des MfS, DS 12/248, 20.3.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
-

Stasi-Unterlagen-Gesetz (StUG), BGBL 67, 20.12.1991. Mit freundlicher Genehmigung des Bundesanzeiger Verlags.

Vorzimmer des Ministers für Staatssicherheit Erich Mielke im sanierten Haus 1 (Stasimuseum) in der Berliner Normannenstraße.
„Die Selbstreinigung des Parlaments ist das Ziel.“ – Der Weg zur Überprüfung der Bundestags-
abgeordneten
Der Bundestag stand nach der Herstellung der deutschen Einheit auch vor der Frage, wie man verhindern könne, dass ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatssicherheit im vereinten Deutschland politische Schlüsselpositionen auf Bundesebene einnehmen könnten. Der Einigungsvertrag regelte bis zu einer abschließenden gesetzlichen Grundlage, dass personenbezogene Daten des Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit für die Überprüfung von Abgeordneten sowie Kandidatinnen und Kandidaten für parlamentarische Mandate mit Zustimmung der Betroffenen herangezogen werden könnten.
Konkrete Regelungen, wie im Falle von Verdächtigungen gegen Mitglieder des Bundestages zu verfahren sei, waren jedoch im Einigungsvertrag nicht festgehalten worden. Noch im Oktober 1990 hielt der Ältestenrat in einer Empfehlung fest, dass das Bundestagspräsidium zu Vorwürfen gegen ein Mitglied des Bundestags ermitteln könne. Voraussetzung dafür war, dass die Vorwürfe oder Behauptungen geeignet seien, das Ansehen des Mitglieds zu beeinträchtigen oder das Ansehen des Bundestags zu beschädigen. Eine Ermittlung konnte nur nach Zustimmung des betroffenen Mitglieds erfolgen. Das Präsidium unterrichtete die betroffene Fraktion oder Gruppe des Mitglieds und konnte – falls Anlass dazu bestand – den Beauftragten der Bundesregierung für die sichere Verwahrung der Akten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit beteiligen. Am 20. Dezember 1990 stimmte der Bundestag der Empfehlung zu.
Diese ersten Regelungen, die eine Zustimmung zur Überprüfung durch das betroffene Bundestagsmitglied voraussetzten, wurden bis Mitte des Jahres 1991 nicht in Frage gestellt. Das änderte sich mit einem Antrag der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Mai 1991. Die Gruppe bezeichnete die Regelungen basierend auf den Empfehlungen des Ältestenrats als unzureichend, da eine Überprüfung erst nach einem konkreten Verdacht gegen den Betroffenen und dessen Zustimmung durchgeführt werden konnte. In der Vergangenheit seien so Überprüfungen von Abgeordneten verhindert worden. Auch das Überprüfungsverfahren sei nicht hinreichend ausgearbeitet. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderten daher eine vollständige Überprüfung der Mitglieder des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung auf mögliche Stasi-Kontakte.
Kritik an diesem Vorhaben kam als erstes von der Fraktion der CDU/CSU. Die Stasi-Akten, die für die Überprüfung herangezogen werden müssten, seien unvollständig und bislang nur teilweise zugänglich. Auch sei es zu Fälschungen gekommen. Eine Regelüberprüfung könne zu mehr „Zwielicht statt mehr Klarheit“ führen. Sie berge auch die Gefahr, die Westdeutschen zu Anklägern der Ostdeutschen zu machen. Die FDP hielt ein neues Verfahren hinsichtlich des beschriebenen Problems für notwendig und erklärte lediglich, dass hierbei verschiedene Verhältnisse austariert werden müssten. Die Gruppe PDS/Linke Liste stimmte in der ersten Lesung des Antrags am 13. Juni 1991 einer grundsätzlichen Überprüfung der Abgeordneten des Bundestags zu. Eine gesetzliche Lösung des Problems sollte sich jedoch am Volkskammergesetz zur Überprüfung auf Stasi-Mitarbeit orientieren. Das Gesetz sei viel differenzierter als der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die PDS/Linke Liste bedauerte, dass im Antrag neben den Regelungen zur Staatssicherheit keine Regelungen zur Überprüfung des Einflusses anderer Geheimdienste auf die Parlamentsarbeit gefordert wurden.
Die SPD erklärte, dass sie noch im Prozess der Meinungsbildung sei. Grundsätzlich sei der Antrag ein willkommener Beitrag, um die Diskussion voranzubringen. Es müssten allerdings Regelungen gefunden werden, die vor dem Grundgesetz Bestand hätten. Artikel 38 des Grundgesetzes garantiert die Unabhängigkeit des Abgeordneten und sichert den Bestand des Mandats gegen einen unfreiwilligen Verlust. Er schließt grundsätzlich Maßnahmen zur Herbeiführung eines Mandatsverlusts aus. Klar sei laut SPD, dass eine Überprüfung durch ein Gremium des Bundestags durchgeführt werden müsse.
In den folgenden Monaten sprachen sich Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP für eine breitangelegte Überprüfung der Bundestagsmitglieder auf freiwilliger Basis aus.
Die Gruppe PDS/Linke Liste legte einen eigenen Antrag vor. Dieser forderte die vollständige Überprüfung von Mitgliedern des Bundestags und der Bundesregierung auf mögliche Kontakte zum MfS/AfNS und zum Bundesnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst, dem Verfassungsschutz und ausländischer Geheimdienste. Dass sich die Überprüfungen nicht allein auf Kontakte zum MfS/AfNS beschränkten, sollte dazu führen, einer „einseitige[n] Abrechnung mit der Geschichte zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik“ entgegenzuwirken.
Erste Gesetzentwürfe wurden am 16. Oktober 1991 eingebracht. Die Fraktionen CDU/CSU, SPD und FDP legten einen gemeinsamen und die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen eigenen Entwurf vor.
Der interfraktionelle Gesetzentwurf zur Änderung des Abgeordnetengesetzes sah vor, dass Mitglieder des Bundestags schriftlich die Überprüfung auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit oder politische Verantwortung für den Staatssicherheitsdienst beim Präsidenten des Bundestags beantragen könnten. Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sollte das Verfahren durchführen. Wenn der Ausschuss das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für den Verdacht einer Tätigkeit für das MfS/AfNS festgestellt hat, findet eine Überprüfung des Bundestagsmitglieds ohne Zustimmung des Mitglieds statt. Der Entwurf regelte das genaue Verfahren und die Rechte des betreffenden Mitglieds. Er legte fest, dass die Ergebnisse der Überprüfung in einer Drucksache veröffentlicht werden können. Dieser Bekanntmachung ist auf Verlangen eine Erklärung des Mitglieds beizufügen.
Der Entwurf der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur „Änderung des Abgeordnetengesetzes und eines Gesetzes zur Änderung des Bundesministergesetzes (Stasi-Überprüfungsgesetz)“ sah vor, dass zu Beginn einer jeden Wahlperiode alle Mitglieder des Bundestags auf eine Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS oder auf ihre Verantwortung für dessen Tätigkeit überprüft werden sollten. Für die laufende Wahlperiode sollte das Verfahren nach Inkrafttreten des Gesetzes durchgeführt werden. Vorgesehen war folgender Ablauf des Verfahrens: Der Bundestag ersucht für die Überprüfung den Sonderbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, kann aber auch eigene Ermittlungen durchführen. Auch alle Mitglieder der Bundesregierung werden nach dem Entwurf vor ihrer Ernennung mit ihrer Einwilligung auf eine Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS oder auf ihre Verantwortung für dessen Tätigkeit überprüft.
Nach der ersten Lesung am 17. Oktober 1991 und der Beratung in den Ausschüssen legte der federführende Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung am 4. Dezember 1991 seine Beschlussempfehlung vor. Sie basierte auf dem interfraktionellen Gesetzentwurf und empfahl dem Bundestag, die Entwürfe von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS/Linke Liste abzulehnen. Die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legte daraufhin einen Änderungsantrag vor, der eine generelle Überprüfung aller Mitglieder des Bundestags auch ohne deren Zustimmung vorsah.
In der Debatte am 5. Dezember 1991, in der über die Beschlussempfehlung abgestimmt wurde, wurde noch einmal der grundlegende Disput zwischen Befürwortern einer freiwilligen Überprüfung der Bundestagsabgeordneten (die drei Bundestagsfraktionen CDU/CSU, SPD und FDP) und den Befürwortern einer generellen Überprüfung (die beiden Bundestagsgruppen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS/Linke Liste) deutlich. Die SPD hatte inzwischen – abgesehen von einzelnen Abgeordneten – ihre Vorbehalte hinsichtlich der Nichtvereinbarkeit der Überprüfung der Abgeordneten mit dem Artikel 38 des Grundgesetzes verworfen. Einige SPD-Abgeordnete wie Otto Schily sahen das Gesetz trotzdem kritisch. Letzterer verwies auf eine fehlende Überprüfung der Bundestagsmitglieder in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Hier hätte man schließlich auch auf eine Mitarbeit bei der Gestapo überprüfen können, man habe es aber nicht getan. Dieses Argument wurde von Dieter Wiefelspütz (SPD) mit dem Hinweis, man sollte die Maßstäbe der Nachkriegszeit nicht in die Gegenwart übertragen, zurückgewiesen. Peter Conradi (SPD) äußerte als westdeutscher Abgeordneter Bedenken, dass es zu einer westdeutschen Selbstgerechtigkeit gegenüber den ostdeutschen Abgeordneten kommen könnte. Die Gruppe PDS/Linke Liste kritisierte abermals, dass keine Überprüfung der Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten in das Gesetz Eingang fand. Das sei Ausdruck einer „Abrechnung mit dem alten DDR-System“. Das Gesetz wurde in der Ausschussfassung angenommen, der Änderungsantrag der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde abgelehnt.
Dokumente
-

Empfehlung des Ältestenrats zu Vorwürfen, die das Ansehen eines Bundestagsmitglieds beschädigen könnten, DS 11/8386, 30.10.1990. Quelle: Deutscher Bundestag
-

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Vollständige Überprüfung von Mitgliedern des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung auf mögliche Stasi-Kontakte, DS 12/586, 17.5.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
-

Antrag der PDS/Linken Liste: Vollständige Prüfung aller Abgeordneten auf mögliche Kontakte zum MfS/AfNS und BND, MAD, VS, andere Geheimdienste, DS 12/1148, 17.9.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
-

Gesetzentwurf der CDU/CSU, SPD und FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, DS 12/1324, 16.10.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
-
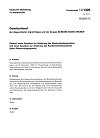
Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abgeordneten Gesetzes, DS 12/1325, 16.10.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
-
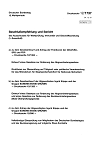
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, DS 12/1737, 4.12.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
-

Gesetzentwurf von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes, DS 12/1738, 5.12.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
Rentenkürzungen für belastete Personen
Wie ging es nach Herstellung der deutschen Einheit mit den Rentenversorgungen von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit weiter? Generell stand der Bundestag vor der Aufgabe der Überleitung des DDR-Rentensystems in das Rentensystem der Bundesrepublik. Zu diesem Zweck formulierten die Fraktionen der CDU/CSU und der FDP einen Gesetzentwurf „zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (Renten-Überleitungsgesetz – RÜG)“. Der Entwurf enthielt auch Regelungen hinsichtlich Versorgungsleistungen für ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS/AfNS. Er sah vor, dass die Zahlungen an ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MfS/AfNS oder deren Angehörige (Witwen und Waisen), die in der DDR das Privileg eines Sonderversorgungssystems genossen hatten, auf 65% des Durchschnitteinkommens begrenzt werden. Die Kappungsgrenze lag bei 600 DM.
In das Sonderversorgungssystem der DDR waren auch weitere Berufsgruppen integriert, u.a. Mitglieder der SED und der Blockparteien. Bei dieser Gruppe gab es eine Begrenzung auf 100 % des Durchschnittseinkommens. Der Versorgungsanspruch sollte nach Artikel 4 des Entwurfs gekürzt oder aberkannt werden, wenn „der Berechtigte oder die Person, von der sich die Berechtigung ableitet, gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen oder in schwerwiegendem Maße die Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer mißbraucht hat. […] Für die Aberkennung oder das Ausmaß der Kürzung sind insbesondere das persönliche schuldhafte Verhalten des Berechtigten oder der Person, von der sich die Berechtigung ableitet, sowie die Auswirkungen des Verstoßes oder Mißbrauchs zu berücksichtigen.“ Die Versorgungs- und Rentenversicherungsträger sollten das Recht haben, wenn konkrete Anhaltspunkte vorlägen, personenbezogene Daten beim Sonderbeauftragten der Bundesregierung für die Stasi-Unterlagen und bei der Zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter einzuholen. Ähnliche Regelungen wurden auch für das Fremdrentengesetz formuliert.
Aufbauend auf diesem Vorstoß der Koalitionsfraktionen kam es wenig später zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der hinsichtlich der Kürzung bzw. Aberkennung von Versorgungsleistungen für ehemalige Stasi-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Entwurf der CDU/CSU und FDP folgte. Ebenso verhielt es sich mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung. Die Ausschussmitglieder der SPD, von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der PDS/Linken Liste hatten der Fassung nicht zugestimmt. Gemeinsam mit der CDU/CSU und der FDP reichte die SPD noch nach Veröffentlichung der Ausschussfassung einen Änderungsantrag ein. Nach diesem Antrag sollte die Kürzung von sogenannten Stasi-Renten auf 800 DM festgelegt werden. Die Ausschussfassung und der Änderungsantrag wurden in der Plenarsitzung am 21. Juni 1991 in zweiter und dritter Lesung angenommen. In der Debatte wurden die Hintergründe dieses Verfahrens genauer erläutert. Laut SPD hätte das Gesetz in der Ausschussfassung bedeutet, dass auch Berufsgruppen etwa aus dem medizinischen, dem naturwissenschaftlichen oder künstlerischen Bereich Rentenkürzungen erfahren hätten. Der Änderungsantrag habe dazu geführt, dass nun nur noch Personen mit leitender Funktion im Staatsapparat, NVA, Polizei, Justiz, Armee und Staatssicherheit sowie in gesellschaftlichen Organisationen eine Begrenzung erfahren sollen. Außerdem handele es sich beim Gesetzesentwurf in der Ausschussfassung um eine Vermischung von Sozial- und Strafrecht, da aus Gründen individueller politisch-moralischer Verfehlungen in die Rentenanwartschaft eingegriffen werden sollte. Eine derartige Vermischung von Sozial- und Strafrecht habe es zuletzt unter den Nationalsozialisten gegeben. Artikel 4 des Gesetzes wäre ein „einmaliger Sündenfall in der Rechtsgeschichte der zweiten deutschen Republik“ (Rudolf Dreßler, SPD) gewesen. In der Nachkriegszeit wurde nie in die Altersversorgungsanwartschaft von NS-belasteten Personen eingegriffen. Durch den Änderungsantrag der Bundestagsfraktionen wurde Artikel 4 durch eine Bestimmung ersetzt, die es nun erlaubte, Ansprüche auf Sonder- und Zusatzrenten ruhen zu lassen.
Auch die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war der Ansicht, dass es keine individuelle Kürzung oder Aberkennung von Rentenansprüchen geben dürfte, „da eine Vermischung von Sozialrecht mit Sanktionen rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht.“ Sie plädierte für eine Orientierung an dem durch die Volkskammer im Juni 1990 erlassenen Rentenangleichungsgesetz, das durch den Einigungsvertrag Bestandsschutz genieße. Auch Menschen, die mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet hatten, müssten die Möglichkeit haben, „ihren Lebensunterhalt mit Erwerbsarbeit oder Sozialleistungen bestreiten zu können, um einen neuen Platz in der Gesellschaft zu finden.“ BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schrieb einen eigenen Änderungsantrag, der jedoch in der Plenarsitzung am 21. Juni 1991 abgelehnt wurde.
In der Debatte brachte die CDU/CSU-Fraktion ihr Bedauern zum Ausdruck, dass es nicht gelungen sei, stärkere Rentenkürzungen für ehemalige Stasi-Mitarbeiter beschließen zu können:
„Die Regierung Modrow hatte sie [die Stasi-Rente] auf 1 200 DM festgesetzt, die Volkskammer hat sie auf 990 DM gekürzt. Nun, im Gesetz, haben wir eine weitere Kürzung vorgenommen; wir haben sie auf 800 DM herabgesetzt. Wir wären gerne noch einen Schritt weitergegangen, konnten uns damit aber nicht durchsetzen.“ (Heinz-Adolf Hörsken (CDU/CSU), Deutscher Bundestag, 12/35, 21.6.1991, S. 2947)
Auf den Verweis vonseiten der SPD-Fraktion, dass im Nachkriegsdeutschland auch NS-Funktionsträger keine Rentenkürzungen bekamen, reagierte der Abgeordnete Joachim Graf von Schönburg-Glauchau (CDU/CSU) mit dem Verweis auf die gesellschaftliche Empörung über die Witwenrente der Ehefrau von Roland Freisler (Präsident des Volksgerichtshofs und Verantwortlicher für zahlreiche NS-Unrechtsurteile). So etwas solle sich nicht wiederholen. Er schloss mit dem Appell:
„Haben Sie mit mir acht und sorgen Sie sich darum, daß die Versorgung der roten Bonzen jetzt nicht junge Leute Rattenfängern zutreibt, die bereits ihr Unwesen treiben.“ (Joachim Graf von Schönburg-Glauchau (CDU/CSU), Deutscher Bundestag, 12/35, 21.6.1991, S. 2956)
Dokumente
-

Gesetzentwurf der CDU/CSU und FDP: Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, DS 12/405. 23.4.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
-

Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, DS 12/630, 29.5.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
-

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, DS 12/786, 19.6.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
-
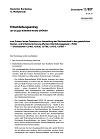
Entschließungsantrag von BÜNDNNIS 90/DIE GRÜNEN zum Entwurf eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, DS 12/827, 20.6.1991. Quelle: Deutscher Bundestag.
-

Änderungsantrag der CDU/CSU, SPD und FDP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Herstellung der Rechtseinheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung, DS 12/829, 20.6.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
Regelungen für den Justizbereich
Hinsichtlich des Personals der Justizbehörden der DDR sah der Einigungsvertrag vor, dass DDR-Richterinnen und -Richter nach dem 3. Oktober 1990 vorläufig im Amt bleiben sollten. Orientiert am DDR-Richtergesetz vom 5. Juli 1990 bestand ihr Richterverhältnis bis zum 15. April 1991 fort. Bis zu diesem Zeitpunkt entschieden Richterwahlausschüsse über den Fortbestand des Richterverhältnisses. Nach Herstellung der deutschen Einheit wurde vonseiten der CDU/CSU und der FDP gefordert, für die Besetzung der Richterwahlausschüsse die Akten der Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter heranzuziehen. Somit sollte verhindert werden, dass belastetes Personal darüber zu entscheiden hatte, wer weiterhin im Justizbereich arbeiten durfte.
Am Anfang der Wahlperiode 12 stand der Deutsche Bundestag dann vor einem tiefgreifenden Problem: Von den ohnehin wenigen DDR-Juristinnen und -Juristen wurde ein Teil aufgrund politischer Gründe entlassen. Gleichzeitig gab es auf dem Gebiet der neuen Bundesländer viele unklare Rechtsverhältnisse, etwa hinsichtlich verschiedener Vermögensverhältnisse. Letzteres verhinderte auch Investitionen von Unternehmen in die neuen Bundesländer und hemmte den gewünschten wirtschaftlichen Aufbau und damit auch die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ostdeutschland an das westdeutsche Niveau. Kurz und knapp: Es fehlte an allen Ecken an juristischem Personal.
Im Februar 1991 schrieben Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen CDU/CSU und FDP einen Antrag, der die Bundesregierung aufforderte, bis zum 8. April 1991 einen Bericht mit Lösungsansätzen für das geschilderte Problem vorzulegen. Im Antrag selbst waren bereits Ideen skizziert, wie man einerseits ostdeutsches Personal schulen und andererseits Anreize schaffen könnte, westdeutsches Personal für die Justiz und Verwaltung in die neuen Länder zu holen.
In der Beratung des Antrags am 28. Februar 1991 erklärte die SPD-Fraktion, dass sie den Berichtsauftrag unterstützt und stellte ihrerseits weitere Fragen an die Bundesregierung.
Die Gruppe PDS/Linke Liste unterstützte das Anliegen, eine funktionsfähige Justiz in den neuen Ländern aufzubauen. Die Gruppe äußerte jedoch auch Bedenken: Personal im Richteramt und in der Staatsanwaltschaft sollte auch aus der ehemaligen DDR kommen und Kenntnisse über die Gesellschaft und die dortigen Verhältnisse haben, um so auch die spezifischen Probleme verstehen zu können. Juristinnen und Juristen aus der ehemaligen DDR sollte das „Recht zum Umdenken und Nachdenken“ eingeräumt werden. Nur so könne verhindert werden, dass in den neuen Ländern die Rede von „Besatzerjustiz“ laut werde. Dieser Ansatz wurde von der Unionsfraktion bestritten, gerade bei der Auswahl der Juristinnen und Juristen müsse man besonders vorsichtig sein. Ansonsten könne die ostdeutsche Bevölkerung kein Vertrauen in den Rechtsstaat aufbauen.
Bundesjustizminister Klaus Kinkel stellte ein vom Bundeskabinett beschlossenes Dreijahresprogramm in Höhe von 360 Millionen DM vor. Das Programm bestand aus mehreren Maßnahmen. Ein Seniorenmodell für Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger sollte durch finanzielle Anreize dazu führen, dass pensioniertes westdeutsches Personal sich für eine bestimmte Dauer für den Dienst in den neuen Bundesländern verpflichtet. Das zweite Modell sah eine Erhöhung der aus den alten Bundesländern in die neuen Bundesländer entsandten Juristinnen und Juristen vor. Außerdem sollten durch Fortbildungsmaßnahmen beispielsweise ostdeutsche Gerichtssekretärinnen und Gerichtssekretäre zu Teilrechtspflegerinnen und Teilrechtspflegern ausgebildet werden.
Die Schlüsselpositionen in der Justiz in Ostdeutschland wurden durch diese Maßnahmen vornehmlich mit westdeutschem Personal besetzt.
Dokument
-

Antrag von Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP: Auf- und Ausbau der öffentlichen Verwaltung und der Justiz in den neuen Bundesländern, DS 12/162, 26.2.1991. Quelle: Deutscher Bundestag
Weitere Debatten zum Thema „Eliten“
 weiterlesen
weiterlesenELITEN | Debatte im Bundestag 1989 – 1990
 weiterlesen
weiterlesenELITEN | Debatte am Zentralen Runden Tisch 1989 – 1990
 weiterlesen
weiterlesenELITEN | Debatte in der Volkskammer 1990
 weiterlesen
weiterlesenELITEN | Debatte im Bundestag 1990 – 1992







